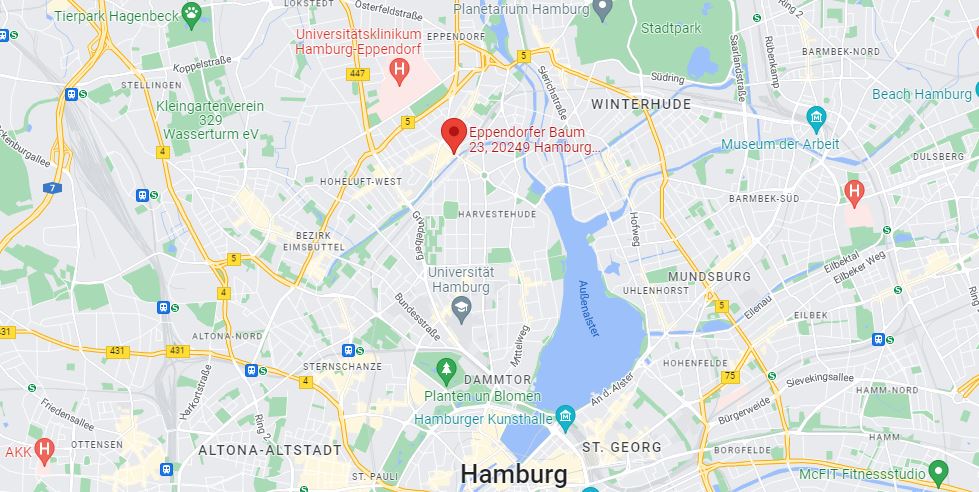Kündigungsschutzklage
Ihr Recht auf faire Behandlung im Arbeitsrecht
Eine Kündigungsschutzklage ist ein zentrales Instrument des deutschen Arbeitsrechts, mit dem Arbeitnehmer gegen eine ihrer Meinung nach ungerechtfertigte Kündigung vorgehen können. Mit dieser Klage kann vor dem Arbeitsgericht die Rechtmäßigkeit der Kündigung überprüft werden.
Kündigungsschutz im deutschen Arbeitsrecht: Ihr Schutz vor willkürlicher Kündigung
Grundsätze des Kündigungsschutzes
Anwendbarkeit des Kündigungsschutzes: Sind Sie geschützt?
Ihr Recht auf faire Kündigung!
Wenn Sie vermuten, dass Ihre Kündigung sozial ungerecht oder diskriminierend ist oder Ihr Arbeitgeber die gesetzlichen Kündigungsfristen nicht eingehalten hat, sollten Sie eine Kündigungsschutzklage in Betracht ziehen.
Die Rolle eines Fachanwalts für Arbeitsrecht bei der Kündigungsschutzklage
Wie ein Fachanwalt für Arbeitsrecht Ihnen helfen kann
Kosten eines Anwalts für Arbeitsrecht
Die Kosten für einen Fachanwalt richten sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und hängen in der Regel vom Streitwert und damit letztlich von der Höhe Ihres Gehaltes ab. Es ist daher ratsam, sich vorab über die voraussichtlichen Kosten zu informieren.
Sie haben Fragen?
Unsere Fachanwälte stehen Ihnen mit langjähriger Erfahrung im Arbeitsrecht gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns!
Ablauf der Kündigungsschutzklage
Klageeinreichung: Ihr Weg zum Arbeitsgericht
Die Klage muss innerhalb einer Frist von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung beim Arbeitsgericht eingereicht werden. Die Klage kann schriftlich bzw. elektronisch oder auch persönlich beim Arbeitsgericht eingereicht werden. Sie sollte die Kündigung und die Gründe, warum sie Ihrer Meinung nach ungültig ist, genau bezeichnen.
Verhandlung: Vom Gütetermin zum Kammertermin
Nach Einreichung der Klage findet zunächst ein Gütetermin statt. Kommt hier keine Einigung zustande, folgt ein Kammertermin. In vielen Fällen enden Kündigungsschutzverfahren mit einem Vergleich. Dabei werden oft Abfindungen oder andere Konditionen wie z.B. die Verlängerung der Kündigungsfrist mit bezahlter Freistellung ausgehandelt.
Ergebnis der Kündigungsschutzklage: Von der Weiterbeschäftigung bis zur Abfindung
Zugunsten des Arbeitnehmers
Zugunsten des Arbeitgebers
Vergleichslösungen
Fazit: Das sollten Sie über die Kündigungsschutzklage wissen
Wichtige Punkte zur Einreichung einer Kündigungsschutzklage
Beachten Sie unbedingt
- die Frist von drei Wochen
- die Formvorschriften der Klageeinreichung
Der Wert der rechtlichen Unterstützung
Sie haben Fragen?
Unsere Fachanwälte stehen Ihnen mit langjähriger Erfahrung im Arbeitsrecht gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns!
Häufig gestellte Fragen zum Thema "Kündigungsschutzklage"
Was ist ein Gütertermin?
Der Gütetermin ist das erste Stadium eines Arbeitsgerichtsprozesses. Hier versucht das Gericht, zwischen den Parteien (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) eine gütliche Einigung zu erzielen, um einen langwierigen Prozess zu vermeiden. Dieser Termin findet in der Regel kurz nach der Einreichung der Kündigungsschutzklage statt und wird von einem einzelnen Richter geleitet. Es gibt keine Formalitäten, und die Parteien sind nicht verpflichtet, Beweise oder Zeugen vorzulegen. Wenn eine Einigung erzielt wird, wird diese vom Gericht protokolliert und hat die Wirkung eines gerichtlichen Urteils.
Was ist ein Kammertermin?
Wenn bei dem Gütetermin keine Einigung erzielt werden kann, wird ein Kammertermin angesetzt. Hierbei handelt es sich um eine formellere Verhandlung, die von einer Kammer, bestehend aus einem Berufsrichter und zwei ehrenamtlichen Richtern (ein Arbeitgeber- und ein Arbeitnehmervertreter), durchgeführt wird. Während des Kammertermins haben beide Seiten die Möglichkeit, Beweise vorzulegen und Zeugen zu befragen. Das Gericht trifft dann eine Entscheidung auf Grundlage der vorgetragenen Fakten und des geltenden Rechts. Kann auch hier keine Einigung erzielt werden, endet der Kammertermin mit einem Urteil des Gerichts.
Wer bezahlt die Kündigungsschutzklage?
Die Kosten für eine Kündigungsschutzklage können sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammensetzen: Anwaltskosten, Gerichtskosten und gegebenenfalls Kosten für Gutachten oder Zeugen. Wer letztlich diese Kosten zu tragen hat, hängt von mehreren Faktoren ab:
- Grundsätzlich ist jede Partei (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) zunächst selbst für die eigenen Anwaltskosten verantwortlich. Das heißt, unabhängig vom Ausgang des Verfahrens muss jeder seine eigenen Anwaltskosten tragen.
- Die Gerichtskosten werden in der ersten Instanz von der Partei getragen, die den Prozess verliert. Bei einem Vergleich fallen keine Gerichtskosten an.
- Falls ein Rechtsschutzversicherung besteht, die Arbeitsrechtsschutz einschließt, kann diese die Kosten für die Kündigungsschutzklage übernehmen. Jedoch können hier Selbstbeteiligungen anfallen und eine 3-monatige Wartezeiten ab Abschluss der Versicherung ist zu beachten.
- Unter bestimmten Voraussetzungen kann für Arbeitnehmer Prozesskostenhilfe beantragt werden. Ist das der Fall, übernimmt die Staatskasse ganz oder teilweise die Kosten des Verfahrens.
Wie viel kostet ein Anwalt für eine Kündigungsschutzklage?
Die Kosten für einen Anwalt können stark variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter:
- Der Streitwert: Das ist der wirtschaftliche Wert der Streitigkeit, der bei Kündigungsschutzklagen in der Regel das Bruttoeinkommen aus drei Monaten darstellt.
- Die Gebührentabelle: Anwälte in Deutschland berechnen ihre Gebühren nach der Rechtsanwaltsvergütungsordnung (RVG), die für verschiedene Tätigkeiten und Verfahrensstadien unterschiedliche Gebühren vorsieht.
- Vereinbarungen zwischen dem Anwalt und dem Mandanten: In bestimmten Fällen kann der Anwalt mit seinem Mandanten eine höhere oder niedrigere Vergütung vereinbaren.
Schreiben Sie uns.
Wir melden uns umgehend!
Oder rufen Sie uns an: 040-8222820-0 (Mo.-Fr. 09:00 – 18:00)
Anfahrt
Martens & Wieneke-Spohler
Rechtsanwälte
Eppendorfer Baum 23
20249 Hamburg